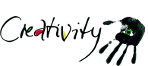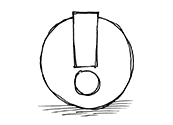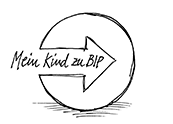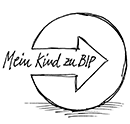Im Rahmen unseres Weiterbildungsprojektes 2024/2025 befassten sich unsere Mitarbeiter mit den Auswirkungen der sich ausbreitenden digitalen Lebenswelt auf die physische und psychische Gesundheit sowie auf das Verhalten von Kindern.
Bestandteil dieser Auseinandersetzung war die diskursive Vertiefung von Anzeigern von und Handlungsschritten im Umgang mit Gefährdung des Kindeswohls sowie präventiven Maßnahmen auf der Basis des Dresdener Kinderschutzordners, der Bewertung von Fallbeispielen und unseren konzeptionsbedingten Sicherheitsrahmen. Eng mit dem Thema "Kindeswohl" verbunden ist die Auseinandersetzung mit den vielschichtigen "Dimensionen des Gewaltbegriffs" und den Formen von Gewalt im Zeitalter digitalen Konsums und Handelns. Neben dem unbestreitbaren Nutzen digitaler Errungenschaften ist das Gefahrenpotenzial, das mit der Nutzung digitaler Medien einhergeht, groß. Digitale Gewalt erscheint nicht nur in Form von Betrug, Identitätsklau, Deepfakes, Grooming, Manipulation von Meinungsbildungsprozessen, Wertestrukturen sowie Konsumverhalten und Kaufentscheidungen. Sie wirkt auch über den Verlust an realen lebensweltlichen Zusammenhängen (Onlinezwang). Sie kann bspw. die Ausbildung tiefgreifender tragfähiger Bindungen einschränken, die Selbstwahrnehmung und das Selbstbild stören (Like-Kultur). Digitale Gewalt wirkt über Diversifizierung und Simplifizierung von Problemlagen, die Fachwissen abwerten und gleichberechtig neben Halb- oder Gar-Nicht-Wissen stellen. Sie kann den lebensweltbezogenen Aufbau fundierten und über Erfahrungen verifizierten kristallinen Wissens und Könnens konterkarieren, die Qualität kognitiver Prozesse, wie Konzentrationsvermögen und Gedächtnisleistungen einschränken, den Aufbau und Erhalt der körperlichen Fitness behindern und bestehende Strukturen des sozialen Zusammenhalts untergraben. Der Frage, ob wir diesen Mechanismen und negativen Auswirkungen der digitalen Welt machtlos gegenüberstehen, ist nicht einfach und abschließend zu beantworten. Auch als Erzieherinnen und Erzieher unterliegen wir diesen Bedingungen. Jedoch ist es entscheidend, wie wir damit umgehen. Genau hier setzte die Suche nach den Prinzipen eines einrichtungsspezifischen Digitalplanes an. Was hilft den Kindern, Medienkompetenz zu erlangen und was schützt sie? Dabei spielen natürlich beide Sphären eine Rolle: einerseits der häuslich und Umfeld geprägte und gestützte Umgang mit digitalen Medien und andererseits jener, den wir innerhalb unserer Einrichtung für sinnvoll erachten und leben wollen. Dem entsprechend begannen wir uns mit weiterführenden Fragen auseinanderzusetzen: Wie verhalten wir uns, wenn Kinder im häuslichen Umfeld vor den Medien "abgeparkt" werden und unterstützt durch Binge-Watching sowie der Verkürzung der abend- und nächtlichen Erholungsspielräume Defizite in der Wahrnehmung und (psycho)motorischen Entwicklung ausbilden? Wie verhalten wir uns, wenn Altersbeschränkungen und Empfehlungen sowie kindgemäße Genre, Inhalte und Formate seitens der häuslichen Bezugspersonen nicht beachtet, nicht gemeinsam mit dem Kind reflektiert und nicht auf die potenziellen Folgen bezogen werden? Wie verhalten wir uns, wenn dann aggressive und Kind schädigende Inhalte und Werte, entgegen auch dem Willen von Eltern anderer Kinder, über gruppendynamische Prozesse ungewollt in das Gruppenleben getragen werden und Kindergartenkinder sich plötzlich darüber sensationsfreudig unterhalten, wie aufregend es war, wenn bei der Titanic Menschen von Deck rutschen und gegen die Schiffsschraube prallen? Wie verhalten wir uns, wenn Kinder Kampfszenen von fiktiven und realen Kriegen in den Gruppenraum holen, Grenzen nicht erkennen und psychisch wie physisch verletzen? Fördern wir in der Beschäftigung mit digitalen Medien in unserer Einrichtung die Ausbildung von Mediensucht und ihren Einfluss? Welcher Umgang mit welchen Medien und welchen Methoden und Inhalten ist zielführend, den Erwerb allgemeiner Grund- und Medienkompetenzen zu ermöglichen, kreative Prozesse anzuregen und Entwicklung sowie Persönlichkeit kindgemäß zu fördern? Auf dem Weg zu einem Digitalplan, der durch unsere Rahmenpläne, Beobachtungen und Erfahrungen gestützt wird, haben wir begonnen, uns zu positionieren und die uns erreichenden Entwicklungen einzuordnen und pädagogisch zu bewerten. Dabei orientieren wir uns an erarbeitete Grundsätze. Einer dieser lautet: "Analog vor digital!" Ausgehend davon haben wir Wege gefunden, digitale Lernspiele in kreativer Weise entsprechend des Alters der Kinder und ihrer Kompetenzen analog anzubahnen. Warum ist das wichtig? Man stelle sich vor, Kinder sehen in einem Zeitrafferfilm, und sei es ein noch so langsamer, die Entstehung einer Pflanze. Ersetzt diese technisierte Zusammenfassung die Aneignung von Kompetenzen, die erworben werden, wenn man selbst wahrnimmt, sät, fürsorgt, beobachtet, dokumentiert, vergleicht, auswertet, im Handeln empfindet, im eignen Handeln und sozialen Kontext denkt? Welche Form ist nachhaltiger und wertbezogener? Auch mit der Zeitraffermethode lassen sich Interesse und Spannung erzeugen sowie Ziele verbinden. Aber es sollte dem grundlegenden Analogen nachgeordnet und darauf aufbauend sein. Ein Handeln auf der Ebene des Kindes – auch das ist Erhaltung des Kindeswohls.
(Helge Hartwig)